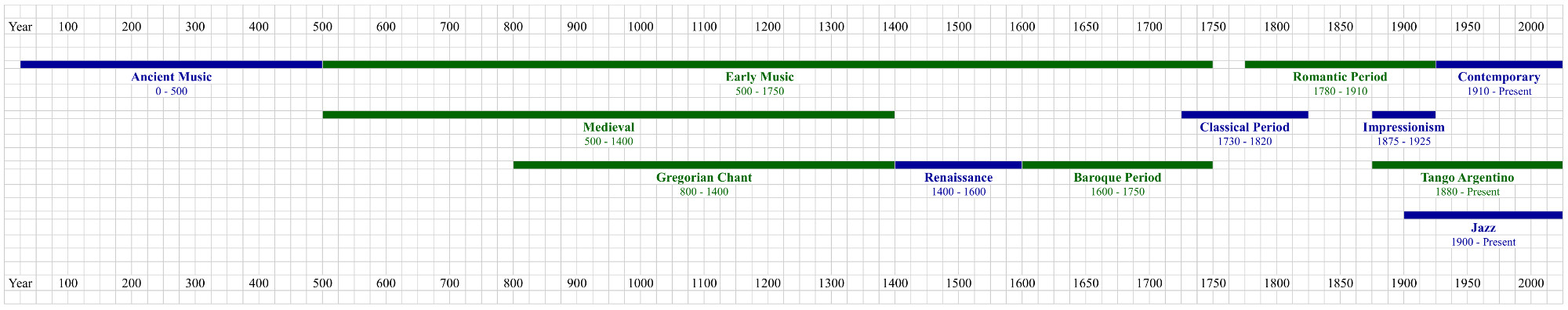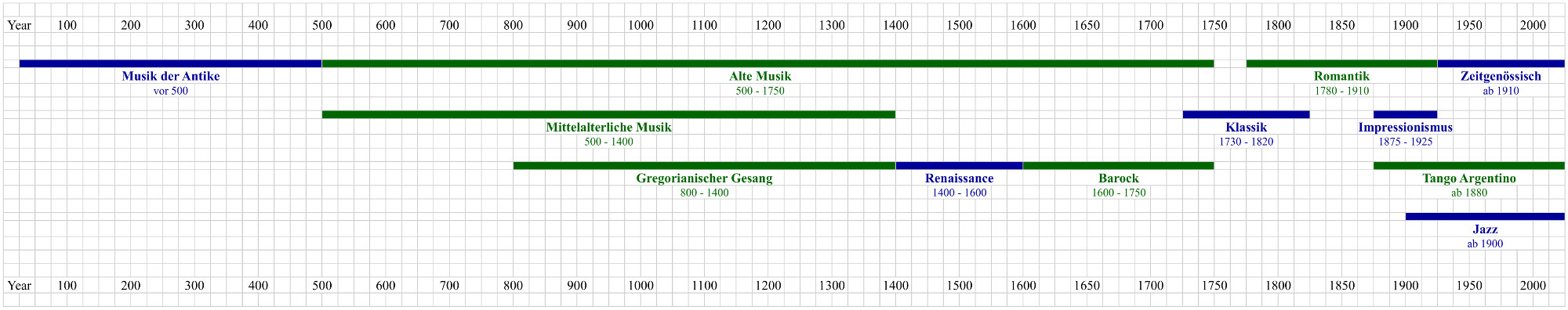Grand Piano Masters · Chopin & Szymanowski
Track
Chopin & Szymanowski
Aleksandra Mikulska spielt
Frédéric Chopin (1810-1849):
· Klaviersonate Nr. 3 in h-Moll Opus 58 · Andante spianato et grande polonaise brillante
· Mazurka Opus 24 Nr. 4 in b-Moll · Scherzo Nr. 2 in b-Moll Opus 31
· Mazurka Opus 33 Nr. 4 in h-Moll · Ballade Nr. 4 in f-Moll Opus 52
Karol Szymanowski (1882-1937):
· Präludien Opus 1 Nr. 2, 7 & 8
Konzertflügel: Steinway & Sons C-227
Ein Konzertmitschnitt aus dem Kloster Maulbronn
HD-Aufnahme · DDD · ca. 83 Minuten
Digitales Album · 12 Tracks
MP3 Album
256 kBit/sec.


 1842 vollendete Chopin seine Ballade f-Moll Opus 52. Ebenso wie die h-Moll-Sonate gehört sie zum Spätwerk des Komponisten, eine Schaffensphase, die durch eine ganz besondere Ausdruckskraft geprägt ist. Chopins Stil weist in dieser Periode eine größere Variabilität und Tiefe auf. Wie auch Tadeusz A. Zielinski in seiner Chopin-Biographie anmerkt: "Jugendlicher Ungestüm und Unmittelbarkeit des Ausdrucks machen einer philosophischen Atmosphäre Platz". Chopin hatte in Paris mit dem polnischen Nationaldichter Adam Mickiewicz Baknntschaft gemacht. Bald verband die beiden Künstler eine innige Beziehung. Die Balladen Mieckwiewiczs, zauberhaft-tragische Geschichten mit katastrophalem Ende, waren Chopin wohl Inspiration zu seinen vier Balladen, darunter auch diejenige in f-Moll - übrigens eine der seltenen Ausnahmen in Chopins Werk für ein außermusikalisches Programm. Mit Ausnahme der Schlusspartien wird in dieser Komposition grelle Dramatik und Virtuosität durch reich nuancierte, emotionsreiche Harmonik ersetzt. Die Innensicht der Seele eines Individuums wird gespiegelt und schwingt sich, nach einer Spannung aufbauenden, zögernden Einleitung auf zu einer musikalischen Erzählung. Es schließt sich ein finsteres erstes Thema mit vielen Variationen im 6/8 Takt an. Das zweite Thema vermittelt eine neue, heitere Perpektive. Die positive Stimmung verweht allerdings, als sich der Schatten des f-Moll-Themas erneut über die Ballade legt und schließlich, nach einer hymnischen Passage und einem hell aufscheinenden Einschub, in einer fast tragischen Coda aufgelöst wird.
1842 vollendete Chopin seine Ballade f-Moll Opus 52. Ebenso wie die h-Moll-Sonate gehört sie zum Spätwerk des Komponisten, eine Schaffensphase, die durch eine ganz besondere Ausdruckskraft geprägt ist. Chopins Stil weist in dieser Periode eine größere Variabilität und Tiefe auf. Wie auch Tadeusz A. Zielinski in seiner Chopin-Biographie anmerkt: "Jugendlicher Ungestüm und Unmittelbarkeit des Ausdrucks machen einer philosophischen Atmosphäre Platz". Chopin hatte in Paris mit dem polnischen Nationaldichter Adam Mickiewicz Baknntschaft gemacht. Bald verband die beiden Künstler eine innige Beziehung. Die Balladen Mieckwiewiczs, zauberhaft-tragische Geschichten mit katastrophalem Ende, waren Chopin wohl Inspiration zu seinen vier Balladen, darunter auch diejenige in f-Moll - übrigens eine der seltenen Ausnahmen in Chopins Werk für ein außermusikalisches Programm. Mit Ausnahme der Schlusspartien wird in dieser Komposition grelle Dramatik und Virtuosität durch reich nuancierte, emotionsreiche Harmonik ersetzt. Die Innensicht der Seele eines Individuums wird gespiegelt und schwingt sich, nach einer Spannung aufbauenden, zögernden Einleitung auf zu einer musikalischen Erzählung. Es schließt sich ein finsteres erstes Thema mit vielen Variationen im 6/8 Takt an. Das zweite Thema vermittelt eine neue, heitere Perpektive. Die positive Stimmung verweht allerdings, als sich der Schatten des f-Moll-Themas erneut über die Ballade legt und schließlich, nach einer hymnischen Passage und einem hell aufscheinenden Einschub, in einer fast tragischen Coda aufgelöst wird.
Die vierte Mazurka in b-Moll ist eines der kunst- und einfallsreichsten Werke des jüngeren Chopin. Das mit vier Auftakten eingeführte Hauptthema trägt leidenschaftliche Züge, im Mittelteil kehrt ein viertaktiges Motiv achtmal auf verschiedenen Tonstufen und mit wechselnder Harmonisierung wieder. Mit der zwischen Moll und Dur schwankenden Coda klingt das Stück träumerisch-elegisch aus. Vier kleinere Formen sind im Opus 33 vereinigt. Teils anmutige, teils derb heitere Charaktere; der breiter ausgesponnenen vierten Nummer in h-Moll eignet ein erzählender Ton, der anekdotisch gedeutet worden ist.
Der spannende Anfang des zweiten Scherzos in b-Moll Opus 31 ist verschieden interpretiert worden. Ein Schüler erzählt: Chopin war damit nie zufrieden, es kam ihm nie fragend und leise genug heraus, er wünschte es "grabesähnlich", wie ein "Beinhaus". Nun hat das erste Sotto-voce-Motiv unleugbar den Charakter einer Frage, die durch die Fortissimo-Fanfare beantwortet wird. Wer aber möchte dabei gleich an Tod und Grab denken? Der Glanz der absteigenden Des-Dur-Passage und das blühende Singen des zweiten Themas scheinen dagegen zu sprechen und zu anderen Assoziationen zu leiten. Trotz der Moll-Tonart ist das zweite Scherzo eine der liebendswürdigsten und pianistisch glänzendsten Kompositionen Chopins, was durch ihre Popularität bestätigt wird. Der sostenuto eintretende A-Dur-Satz hat einen romantisch-poetischen Klang, die ersten zwölf Takte könnten bei Schumann stehen. Ein cis-Moll-Satz, der im Durchführungsteil eine bedeutsame Rolle spielt, zitiert in der Nebenstimme den dritten und vierten Takt des Sostenuto. In der Reprise werden die ersten Entwicklungen um ein geringes modifiziert. Die Modulationen der Stretta, die feurig drängenden, empathischen Akkordfolgen führen zu einem glänzenden, seine Wirkung nie versagenden Schluss.
Die Sonate Nr. 3 h-Moll Opus 58 ist eine der prächtigsten und bedeutungsvollsten Kompositionen im chopinschen Œuvre. 1844, fünf Jahre vor seinem Tod in relativ kurzer Zeit komponiert, ist sie eine von insgesamt drei Klaviersonaten Chopins. Während sein erster Beitrag zur Gattung, die Sonate c-Moll Opus 4 noch den Duktus einer Studie besitzt, beschreiben die anderen beiden Sonaten künstlerisch den Höhepunkt der romantischen Klaviersonatenform. Chopin griff, sowohl in der Sonate h-Moll als auch in der 1839 entstandenen Sonate b-Moll Opus 35 die klassische Form auf, um sie mit lyrischem Geist zu erfüllen. Während diese einen tragischen Charakter hat, strebt Opus 58 aus dem Dunkel zum Licht und gleicht fast einer epischen Erzählung. "Die h-Moll-Sonate steigt aus der tragischen Tiefe in die grandiose Höhe. Der Mensch, seine Hoffnung und seine innere Kraft besiegen die Dunkelheit" charakterisiert Mikulska die Komposition. Die h-Moll-Sonate ist viersätzig gehalten, an zweiter Stelle steht ein Scherzo. Wie kein anderes Werk Chopins steht Opus 58 in der Tradition Johann Sebastian Bachs. Die Sonate basiert auf einer kontrapunktischen Struktur. Die Stimmen begegnen sich ständig, laufen nebeneinander her und durchdringen einander und steuern dabei auf ein Finale in wildem "presto nontanto" zu, das in einem triumphalen, fast rauschhaften Feuerwerk in H-Dur endet.
 Es gibt noch mehr solcher Original-Werke unter Karol Szymanowskis Kompositionen. In der Tat hat seine ganze Musik einen einzigartigen Charme, den Liebhaber der zeitgenössischen Musik sehr attraktiv finden dürften. Szymanowskis älteste bekannte Kompositionen, die Präludien Opus 1, sind seine eigene Auswahl von neun seiner ersten Klavier-Miniaturen. Aus Veröffentlichungsgründen im Jahre 1900 ausgewählt, gehen die Präludien in der Mehrzahl auf die Jahre 1899 und 1900 zurück, obwohl zwei, die Nummern 7 und 8, sehr gut früher, im Jahr 1896 geschrieben sein könnten. Das Verlagshaus der Jungen Polnischen Komponisten (Spólka Nakladowa Mlodych Kompozytorów Polskich) veröffentlichte die Kollektion jedoch erst 1905. Erwähnenswert ist, dass eine der Opus 1-Präludien 1903 eine Belobigung beim Konstanty-Lubomirski-Wettbewerb in Warschau erhalten hatte. Die Präludien erinnern deutlich an Frederik Chopins Musik, in der Art und Weise, wie Form und Klaviertextur angelegt sind. Bei acht in Moll komponierten Präludien ist Lyrik der dominierende Charakter, dennoch kann man auch Szymanowskis Interesse an den zeitgenössischen Tendenzen in der Musik erkennen, vor allem am Beispiel von Alexander Skrjabin (die charakteristischen Doppelschläge/Wendungen der Harmonie).
Es gibt noch mehr solcher Original-Werke unter Karol Szymanowskis Kompositionen. In der Tat hat seine ganze Musik einen einzigartigen Charme, den Liebhaber der zeitgenössischen Musik sehr attraktiv finden dürften. Szymanowskis älteste bekannte Kompositionen, die Präludien Opus 1, sind seine eigene Auswahl von neun seiner ersten Klavier-Miniaturen. Aus Veröffentlichungsgründen im Jahre 1900 ausgewählt, gehen die Präludien in der Mehrzahl auf die Jahre 1899 und 1900 zurück, obwohl zwei, die Nummern 7 und 8, sehr gut früher, im Jahr 1896 geschrieben sein könnten. Das Verlagshaus der Jungen Polnischen Komponisten (Spólka Nakladowa Mlodych Kompozytorów Polskich) veröffentlichte die Kollektion jedoch erst 1905. Erwähnenswert ist, dass eine der Opus 1-Präludien 1903 eine Belobigung beim Konstanty-Lubomirski-Wettbewerb in Warschau erhalten hatte. Die Präludien erinnern deutlich an Frederik Chopins Musik, in der Art und Weise, wie Form und Klaviertextur angelegt sind. Bei acht in Moll komponierten Präludien ist Lyrik der dominierende Charakter, dennoch kann man auch Szymanowskis Interesse an den zeitgenössischen Tendenzen in der Musik erkennen, vor allem am Beispiel von Alexander Skrjabin (die charakteristischen Doppelschläge/Wendungen der Harmonie).
Die Opus 1-Präludien sind seit jeher beliebt bei den Pianisten und wurden in das Repertoire von Virtuosen wie Artur Rubinstein und Felicja Blumental aufgenommen. Sie wurden ebenfalls auf andere Instrumente übertragen, und diese Transkriptionen sind so bekannt wie das originale Klavierwerk. Eine solche Transkription vom Präludium Nr. 1 wurde für Violine oder Cello und Klavier von Crazyna Bacewicz im Jahr 1948 geschaffen. Sie führte es unter lautem Beifall mit ihrem Bruder Kiesjstut Bacewicz auf und ihre Interpretation wurde unter dem Label "Polskie Nagrania - Muza 1597" im Jahre 1950 auf einer Langspielplatte veröffentlicht. Die ersten beiden Präludien wurden früher von Stanislaw Mikuszewski anlässlich der Einsegnungszeremonie von Szymanowskis Sarkophag in Krakaus Na Skalce-Kirche im Jahre 1938 für Streichquartett umgeschrieben.

S
ensitivität, musikalische Ausdrucksfähigkeit und makellose, transparente Spieltechnik: Aleksandra Mikulska verkörpert in höchstem Maße diese einst von Frédéric Chopin geforderten Eigenschaften. Einmütig bestätigen dies Lehrer, Kritiker, Juroren sowie das Publikum. Längst zeichnet sich Aleksandra Mikulska nicht mehr nur durch ihre ureigene, außergewöhnlich ehrliche Chopin-Interpretation aus, die ihr bereits 2005 den Großen Sonderpreis als beste polnische Pianistin beim Internationalen Frédéric-Chopin-Wettbewerb in Warschau einbrachte und welche 2010 mit ihrem Chopin-CD-Debüt auf dem Plattenmarkt begeistert Aufnahme fand. Mit ihren "leidenschaftlich" und "hinreißend" vorgetragenen Interpretationen von Haydn, Beethoven und Chopin bescherte Aleksandra Mikulska den Bodenseefestivals 2010 sowie 2011 "pianistische Sternstunden".
Der Besuch einer Hochbegabtenklasse der Warschauer Talentschule "Karol Szymanowski Musiklyceum", mehrfache Förderpreise des polnischen Staates sowie zahlreiche Preise bei internationalen Wettbewerben bildeten den Grundstein für die hochkarätige internationale Ausbildung der jungen Pianistin.
Aleksandra Mikulska war bereits als Gymnasiastin Schülerin von Peter Eicher in Mannheim, bei dem sie nach ihrem Abitur an der Musikhochschule Karlsruhe studierte. Studienbegleitend sammelte sie wertvolle Impulse bei internationalen Meisterkursen, unter anderem bei Diane Andersen sowie Lev Natochenny. Nach ihrem mit Auszeichnung absolvierten Studium zog es sie 2004 ins Musikland Italien an die Klavierakademie "Accademia Pianistica incontri col maestro" in Imola. Lazar Berman und Michael Dalberto wurden dort bis 2008 zu ihren wichtigsten Impulsgebern. Ihre Ausbildung vervollkommnete sie ab 2006 mit einem Studium in der Meisterklasse von Arie Vardi an der Musikhochschule Hannover, an der sie 2010 ihr Konzertexamen ablegte.
Aleksandra Mikulska vereint die drei musikalischen Traditionen der Länder Polen, Deutschland und Italien zu einem einmaligen, persönlichen und unverwechselbaren Stil. Sie ist Gast bei internationalen Festivals, wie dem Bodenseefestival, den "Klosterkonzerten Maulbronn", dem Klavierzyklus "Musik am Hochrhein in der Schweiz", dem "Meranofest" in Italien und dem "Lapland Piano Festival". Darüber hinaus gibt Aleksandra Mikulska Soloabende in ganz Europa und konzertiert mit Orchestern in Deutschland, Italien und Belgien.
Ein Schwerpunkt des künstlerischen Wirkens der gebürtigen Warschauerin liegt in der Verbreitung der Musik der großen Komponisten ihrer Heimat. Aleksandra Mikulska ist Vizepräsidentin der "Chopin-Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland e.V." in Darmstadt und sitzt im Vorstand der "Deutsch-Polnischen Gesellschaft Landesverband Baden Württemberg". Darüber hinaus ist sie Mitglied der "Karol-Szymanowski-Gesellschaft" in Zakopane (Polen) und pflegt eine enge Zusammenarbeit mit den Musikgesellschaften "De Musica" in Warschau sowie dem Deutsch-Polnischen Kulturverein "Salonik".
Ihr Tonträger-Debüt erschien 2010 und ist Werken von Frédéric Chopin gewidmet. Im Herbst 2011 veröffentlichte Aleksandra Mikulska unter dem Titel "Expressions" ihre zweite CD mit Werken von Haydn, Szymanowski und Chopin. Beide Einspielungen fanden höchsten Zuspruch bei Publikum und Fachpresse. Inzwischen legt sie bereits ihr drittes Album vor, auf dem sie die vier Balladen von Frédéric Chopin präsentiert.
A
uthentic Classical Concerts zu veröffentlichen, heisst für uns, herausragende Aufführungen und Konzerte für die Nachwelt festzuhalten und zu vermitteln. Denn Künstler, Publikum, Werk und Raum treten in einen intimen Dialog, der in Form und Ausdruck - in seiner Atmosphäre - einmalig und unwiederbringlich ist. Diese Symbiose, die Spannung der Aufführung dem Hörer in all ihren Facetten möglichst intensiv erlebbar zu machen, indem wir die Konzerte direkt in Stereo-Digital-HD aufzeichnen, sehen wir als Ziel, als Philosophie unseres Hauses. Das Ergebnis sind einzigartige Interpretationen von musikalischen und literarischen Werken, schlichtweg - audiophile Momentaufnahmen von bleibendem Wert. Blühende Kultur, dem Publikum vor Ort und nicht zuletzt auch Ihnen zur Freude, sind somit jene Werte, welche wir in unseren Editionen und Reihen dokumentieren.
Die Konzerte im UNESCO-Weltkulturerbe Kloster Maulbronn, bieten in vielfacher Hinsicht die idealen Voraussetzungen für unser Bestreben. Es ist wohl vor allem die Atmosphäre in den von romantischem Kerzenlicht erhellten Gewölben, der Zauber des Klosters in seiner unverfälschten sakralen Ausstrahlung und Ruhe, die in ihrer Wirkung auf Künstler und Publikum diese Konzerte prägen. Renommierte Solisten und Ensembles der großen internationalen Bühnen sind gerne und vor allem immer wieder hier zu Gast - genießen es in der akustisch und architektonisch vollendeten Schönheit des Weltkulturerbes in exquisiten Aufführungen weltliche und sakrale Werke darzubieten, die wir in unserer Edition Kloster Maulbronn dokumentieren.
Der große Konzertflügel ist unbestritten der König unter den Instrumenten. Wir könnten jetzt auf seine unvergleichliche Dynamik, den zartesten Klang im leisen Moll bis hin zum mächtigen Anschlag im Fortissimo eingehen oder von seiner beeindruckenden Größe und Eleganz schwärmen. Doch wirklich faszinierend ist die Individualität, denn jedes Instrument ist ein Unikat - von Meisterhand geschaffen. Es hat ein Eigenleben, auf das sich der Virtuose einlässt und so das Werk des Komponisten zum Leben erweckt. In unserer Reihe Grand Piano Masters gehen wir auf den Charakter, auf die Seele des großen Konzertflügels ein und erleben während der Aufführung den Dialog zwischen Instrument, Virtuose und Raum.
Andreas Otto Grimminger & Josef-Stefan Kindler, K&K Verlagsanstalt
- Anmelden / Registrieren um zu kommentieren

- Share