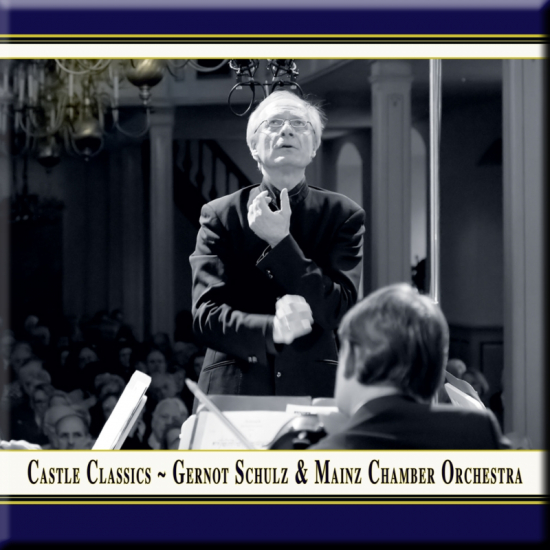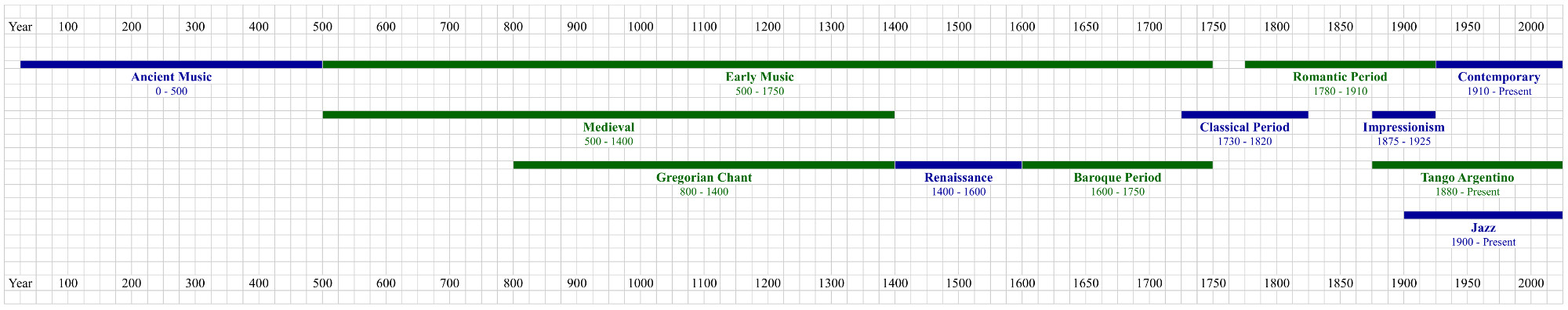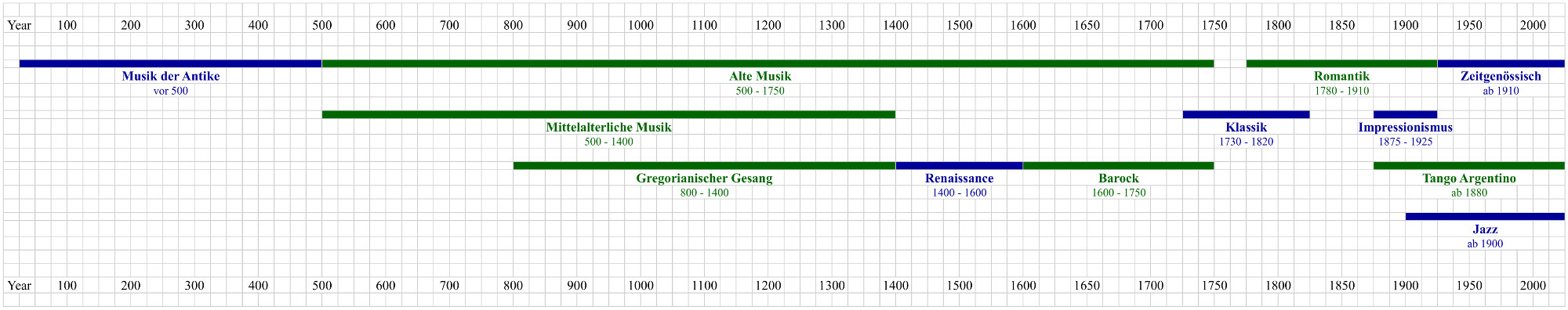Castle Classics · Mozart, Haydn & Elgar
Mozart, Haydn & Elgar
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791):
Sinfonie Nr. 29 in A-Dur, KV 201
& Konzert für Horn & Orchester Nr. 2
in Es-Dur, KV 417
Joseph Haydn (1732-1809):
Cassatio für vier Hörner & Streichorchester
in D-Dur, Hob. deest
Edward Elgar (1857-1934):
Serenade für Streichorchester in E-moll, Opus 20
Mainzer Kammerorcherster · Künstl. Leitung: Gernot Schulz
Solisten (Horn): Sibylle Mahni, Benedicte Elnes, Jannik Neß & Moritz Haas
Ein Konzertmitschnitt aus dem Schloss Bad Homburg
HD-Aufnahme · DDD · Spielzeit: ca. 60 Minuten


E
rhaltenswertes und hörenswert Neues, musikalische Kostbarkeiten aus Tradition und Avantgarde - beides undenkbar ohne den Nährboden Europa - dokumentieren wir an historischer Stelle in unseren Produktionen aus der Reihe "Castle Concerts" in Zusammenarbeit mit Volker Northoff.
Die Schlosskirche im Landgrafenschloss Bad Homburg, erbaut Ende des 17. Jahrhunderts, ist einer der schönsten und intimsten Konzertsäle Europas. Lange in Vergessenheit geraten, überstand sie die Wirren des 20. Jahrhunderts. Erst in den 1980er Jahren erkannten engagierte Bad Homburger Bürger ihren Wert. Auf ihre Initiative wurden der barocke Raum und die prächtige Bürgy-Orgel von 1787 originalgetreu mit behutsamer Liebe zum Detail restauriert und rekonstruiert. Heute erstrahlt die Schlosskirche in neuem Glanz und wird durch die Konzertreihe "Castle Classics" mit musikalischen Höhepunkten fürstlich geschmückt.
Andreas Otto Grimminger & Josef-Stefan Kindler, K&K Verlagsanstalt
Die Werke
Edward Elgar: Serenade für Streichorchester in e-moll, Opus 20
Edward Elgar war ein musikalischer selfmade man, der sich anfangs an der kleinen Form übte, um sich Schritt für Schritt den großen musikalischen Gattungen zu nähern. Ein Meilenstein auf diesem Weg war die äußerst reizvolle Serenade für Streichorchester, die im Jahre 1892 entstand. Elgar griff dabei vermutlich auf eine verschollene Komposition zurück, die aus dem Jahre 1888 stammte. Unmittelbarer Auslöser für die endgültige Version des Werkes scheint die Einladung einer Bekannten zum Besuch der Bayreuther Festspiele gewesen sein. Elgar, der sich bei seinen autodidaktischen Studien auch intensiv mit Richard Wagner beschäftigte, nahm sich daraufhin dessen Oper "Parsifal" vor, was deutliche Spuren in der Serenade hinterlassen hat.
Die Serenade war die erste Komposition, mit der er in vollem Umfang zufrieden war. Der Verleger Novello, dem er das Stück anbot, war offenbar anderer Meinung. Er verweigerte die Annahme mit der Begründung, dass diese Art von Musik praktisch unverkäuflich sei. Heute gehört das liebenswerte dreisätzige Stück zu den am meisten aufgeführten Werken des später auch mit großen Werken berühmt gewordenen Engländers.
W. A. Mozart: Konzert für Horn und Orchester in Es-Dur, KV 417
Unter Mozarts Solokonzerten für Bläser finden sich drei vollständig überlieferte Konzerte für Horn (KV 417, 447, 495). Während Mozart seine Violin- und Klavierkonzerte in erster Linie für den Eigengebrauch geschrieben hat, sind die Bläserkonzerte meist spontan und aus kurzfristig sich bietendem Anlass für verschiedene andere Solisten entstanden. Dennoch gehören sie ohne Ausnahme zu den wichtigsten Beiträgen zur solistischen Konzertmusik im 18. Jahrhundert.
Die drei vollständig überlieferten Hornkonzerte, alle in der Tonart Es-Dur stehend, sind dem späteren Schaffen Mozarts zuzuordnen. KV 417 entstand im Jahre 1783. Fast alle Werke dieser Besetzung schrieb Mozart für den österreichischen Waldhornisten Joseph Leutgeb (1732-1811), der schon früh zum Freundeskreis der Familie gehört hat. Leutgeb war über die Grenzen Österreichs hinaus ein gefragter Solist. In ihm fand Mozart nicht nur einen Interpreten, sondern wohl auch einen Berater bei der Gestaltung der solistischen Partien. Man muss sich dabei vergegenwärtigen, dass die Spielmöglichkeiten des Horns zur damaligen Zeit stark eingeschränkt und mit heutigen Verhältnissen nicht zu vergleichen waren.
Das sogenannte Inventionshorn, das gegenüber dem Waldhorn eine raschere und präzisere Stimmung erlaubte, befand sich noch im Stadium seiner Entwicklung. Die Technik des Stopfens, mit der Töne außerhalb der Naturtonreihe erzeugt werden konnten, erforderte eine besondere Kunstfertigkeit. Leutgeb hat diese Technik virtuos beherrscht und es offensichtlich auch vermocht, Mozart zu Kompositionen zu inspirieren, die in idealer Weise auf den Klangcharakter und die Möglichkeiten des Soloinstruments abgestimmt sind. Beseelte und ausdrucksvolle Hornkantilenen gehören denn auch zu den Hauptmerkmalen der Hornkonzerte Mozarts, besonders in den langsamen Mittelsätzen. Eine weitere Gemeinsamkeit aller vier Konzerte bilden die fröhlich-vitalen Jagdhornmotive in den Schlusssätzen, die auf die ursprüngliche Bestimmung des Instruments hinweisen. Die Eröffnungssätze der vier Konzerte gehören dem Wettstreit des Solisten mit dem Orchester. Nicht aber eine dramatische Form des Konzertierens, wie sie Mozart etwa in seinen Klavierkonzerten ausgebildet hat, steht im Vordergrund, sondern ein unbekümmerter, im besten Sinne des Wortes unterhaltender konzertanter Stil. In ihrer meisterlichen Verbindung von Kantabilität und spielfreudiger Virtuosität sind Mozarts Hornkonzerte phantasievoll und individuell gelöste Gattungsbeispiele, die bis heute zu Recht zu den Gipfelwerken ihres Genres gehören.
J. Haydn: Cassatio für 4 Hörner und Streicher in D-Dur, Hob. deest
Cassatio bzw. Kassation nannte man in der Wiener Klassik ein Divertimento, das im Freien aufgeführt wurde. Joseph Haydn hat in seiner frühen Zeit als Vizekapellmeister am Hof des ungarischen Magnaten Nikolaus von Esterházy eine ganze Reihe solcher Werke geschrieben. Sie zeigen - wie die D-Dur-Cassatio unseres Konzerts - den klassischen Aufbau des Wiener Divertimentos: zwei schnelle Ecksätze und zwei Menuette, die ein Adagio umschließen.
Das Manuskript unserer Cassatio entdeckte der Haydn-Forscher Howard Robbins-Landon im Archiv des Grafen Christian Glam Gallas, der in den 1770er Jahren viele neue Werke Haydns aus Wien bestellte. Obwohl es weder in Haydns sog. Entwurf-Katalog noch im Hoboken-Verzeichnis der Werke Haydns vorkommt, handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um ein echtes Werk.
Zur Besetzung des Stückes bemerkte Robbins-Landon: "In der Esterházy-Kapelle hatte Haydn vier Hornisten zur Verfügung: einige D-Dur-Symphonien aus den Jahren 1761 bis 1765 ziehen alle vier Spieler heran. Bei zwei Symphonien handelt es sich um typische Jagd-Symphonien, die Anlage der vier Hörner ist jener unserer Cassation sehr ähnlich." In diesem Konzert werden die vier Hörner gespielt von Sibylle Mahni, Benedicte Elnes, Jannik Neß und Moritz Haas.
W. A. Mozart: Sinfonie Nr. 29 in A-Dur, KV 201
Mozart vollendete die Sinfonie KV 201 am 6. April 1774 in Salzburg. Sie gilt als vorläufiger Höhepunkt in Mozarts sinfonischem Schaffen. Dies beruht neben der Länge und der ausformulierten Sonatensatzform des 1., 2. und 4. Satzes, alle mit ausdrücklicher Coda, auf der Kontrapunktik insbesondere im ersten Satz und der Ausdrucksstärke, beispielsweise in der langen Durchführung im vierten Satz.
In diesem Sinne äußerte sich Albert Einstein 1953: "Es ist ein neues Gefühl für die Notwendigkeit der Vertiefung der Sinfonie durch imitatorische Belebung, ihre Rettung aus dem bloß Dekorativen durch kammermusikalische Feinheit. Die Instrumente wandeln ihren Charakter; die Geigen werden geistiger, die Bläser vermeiden alles Lärmende, die Figurationen alles Konventionelle. Der neue Geist dokumentiert sich in allen Sätzen."

D
as Mainzer Kammerorchester wurde 1955 von Prof. Dr. Günter Kehr gegründet, der es bis zu seinem Tode 1989 leitete. Rund 40 bis 50 Konzerte pro Jahr haben es in die ganze Welt geführt, 130 LPs und CDs wurden produziert, dazu zahlreiche Rundfunkaufnahmen. Der unvergleichliche Musizierstil von Günter Kehr setzte Maßstäbe und hat ein Zeitalter mit geprägt. Dieser Tradition fühlt sich das Orchester verpflichtet. Jeder Musiker wird mit interessanten musikalischen Aufgaben betraut, so dass sich in Reihen des Ensembles viele versierte Solisten finden. Oft werden Interpretationen von den Musikern selbst unter der Leitung der Konzertmeister erarbeitet. Die Musiker sind in der Regel hauptberuflich nicht in Sinfonieorchestern tätig, sondern in Kammermusikvereinigungen. Das ermöglicht kammermusikalisch orientierte Probenarbeit unter der Leitung der Konzertmeister. Auf diese Weise ist eine besondere Kollegialität entstanden, die sich in spontaner Musizierfreude widerspiegelt. Etwa 20 in den letzten Jahren entstandene CDs legen Zeugnis ab von dem außergewöhnlichen Niveau dieses Orchesters. Nach dem Tod von Günter Kehr hat der Geiger Volker Müller ehrenamtlich die musikalische Leitung des Mainzer Kammerorchesters übernommen. Gemeinsam mit seiner Frau, der Flötistin Renate Kehr, pflegt er das künstlerische Erbe des Orchesters und führt es zu neuen Entwicklungen.

P
rof. Gernot Schulz, langjähriger Berliner Philharmoniker und ehemaliger Assistent Leonard Bernsteins und Sir Georg Soltis ist heute ein international gefragter Dirigent. Von den Berliner Philharmonikern bis zum Rundfunkorchester Seoul, vom Orquestra Filarmonica Mexico City bis zu den Budapester Philharmonikern - bei zahlreichen renommierten Orchestern in Europa, Südamerika und Asien ist Gernot Schulz ein gern gesehener Gast. Er dirigierte bei den Berliner Festwochen, den Frankfurter Festen, den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, beim Schleswig-Holstein-Musikfestival, bei den Opernfestspielen in Rheinsberg sowie bei dem von Claudio Abbado initiierten Kontrapunkte-Festival der Osterfestspiele Salzburg. Mit verschiedenen Ensembles der Berliner Philharmoniker verbindet ihn eine regelmäßige Zusammenarbeit. Sein Repertoire reicht von der klassisch-romantischen Symphonik bis hin zu Uraufführungen der bedeutenden Komponisten der Gegenwart. CD-Einspielungen u. a. - gemeinsam mit Simon Rattle und den Berliner Philharmonikern - der Musik zu dem Film "Rhythm is it" sowie des Opernfragments "Adrast" von Franz Schubert wurden von Sony Classical, Wergo , Profile Edition und Ars Produktion veröffentlicht.
A
uthentic Classical Concerts zu veröffentlichen, heisst für uns, herausragende Aufführungen und Konzerte für die Nachwelt festzuhalten und zu vermitteln. Denn Künstler, Publikum, Werk und Raum treten in einen intimen Dialog, der in Form und Ausdruck - in seiner Atmosphäre - einmalig und unwiederbringlich ist. Diese Symbiose, die Spannung der Aufführung dem Hörer in all ihren Facetten möglichst intensiv erlebbar zu machen, indem wir die Konzerte direkt in Stereo-Digital-HD aufzeichnen, sehen wir als Ziel, als Philosophie unseres Hauses. Das Ergebnis sind einzigartige Interpretationen von musikalischen und literarischen Werken, schlichtweg - audiophile Momentaufnahmen von bleibendem Wert. Blühende Kultur, dem Publikum vor Ort und nicht zuletzt auch Ihnen zur Freude, sind somit jene Werte, welche wir in unseren Editionen und Reihen dokumentieren.
Erhaltenswertes und hörenswert Neues, musikalische Kostbarkeiten aus Tradition und Avantgarde - beides undenkbar ohne den Nährboden Europa - dokumentieren wir an historischer Stelle in unseren Produktionen aus der Reihe Castle Concerts in Zusammenarbeit mit Volker Northoff.
Andreas Otto Grimminger & Josef-Stefan Kindler, K&K Verlagsanstalt
Edward Elgar (1857-1934):
Serenade für Streichorchester in E-moll, Opus 20
1. I: Allegro piacevole ~ 2. II: Larghetto
3. III: Allegretto
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791):
Konzert für Horn & Orchester Nr. 2 in Es-Dur, KV 417
Solistin: Sibylle Mahni ~ Horn
4. I: Allegro maestoso ~ 5. II: Andante
6. III: Rondo
Joseph Haydn (1732-1809):
Cassatio für vier Hörner & Streichorchester in D-Dur, Hob. deest
Solisten (Horn): Sibylle Mahni, Benedicte Elnes, Jannik Neß & Moritz Haas
7. I: Allegro moderato ~ 8. II: Menuet
9. III: Adagio ~ 10. IV: Menuet
11. V: Finale - Allegro
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791):
Sinfonie Nr. 29 in A-Dur, KV 201
12. I: Allegro moderato ~ 13. II: Andante
14. III: Menuetto ~ 15. IV: Allegro con spirito
Ein Konzertmitschnitt aus dem Schloss Bad Homburg vom 7. April 2013, dokumentiert von Andreas Otto Grimminger & Josef-Stefan Kindler in Kooperation mit Volker Northoff.
Tonmeister: Andreas Otto Grimminger.
Mastering: Andreas Otto Grimminger & Josef-Stefan Kindler.
Photography: Josef-Stefan Kindler. Artwork & Coverdesign: Josef-Stefan Kindler.
- Anmelden / Registrieren um zu kommentieren

- Share