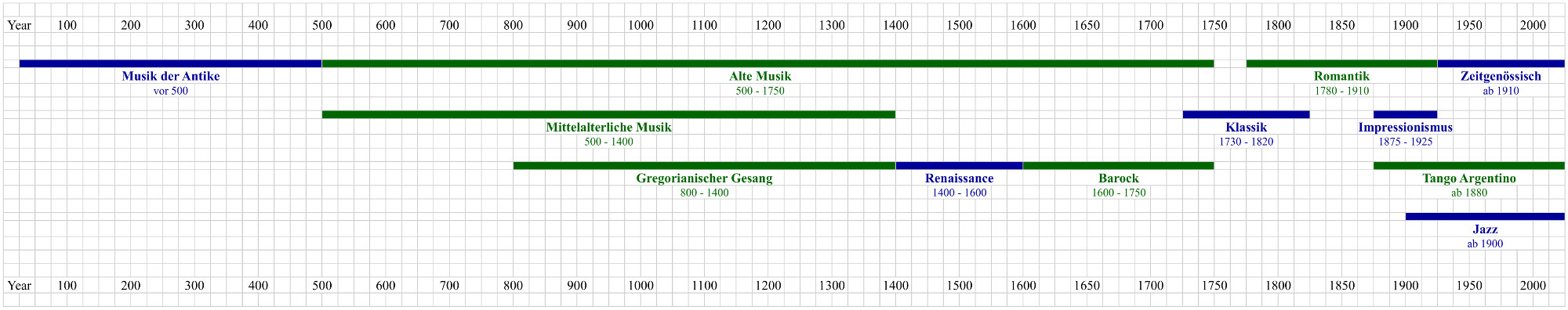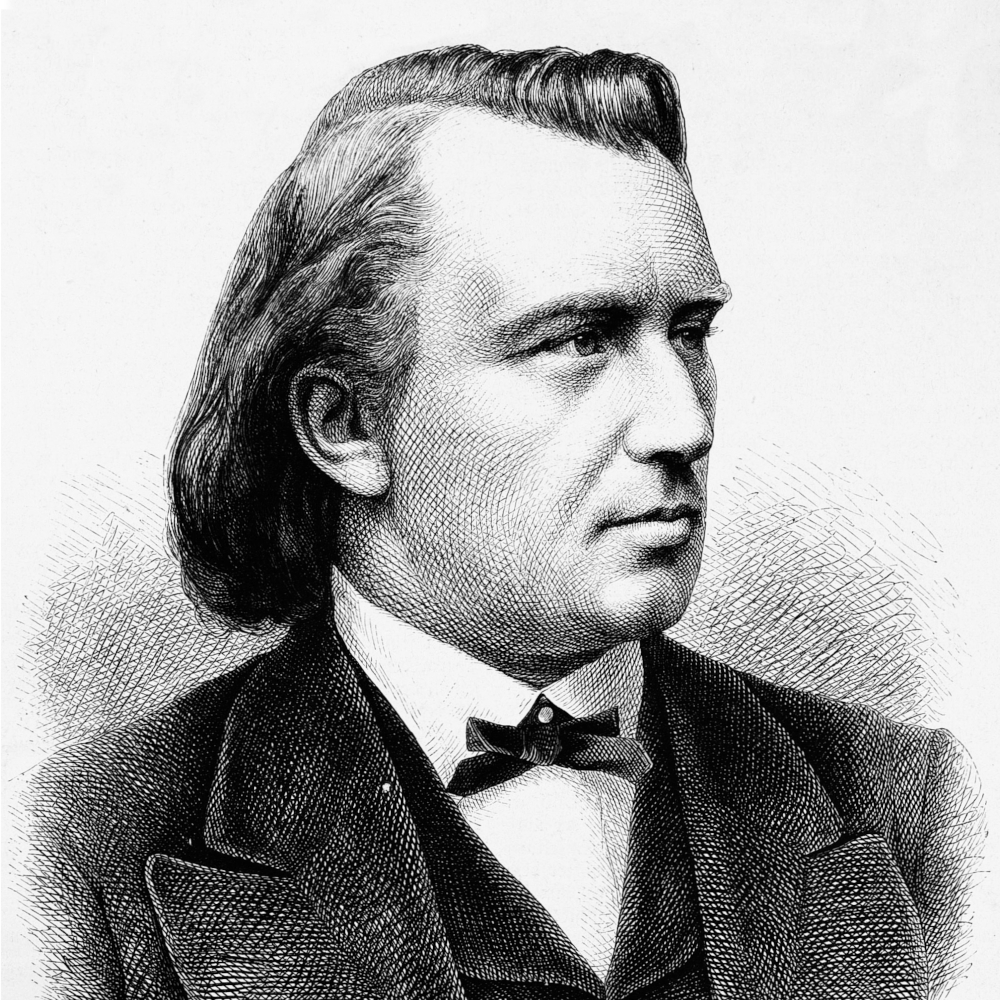Ludwig van Beethoven: Klavierkonzert Nr. 2 in B-Dur, Opus 19
Mittlerweile kann man davon ausgehen, dass am 29. März 1795 dem Wiener Publikum im Hofburgtheater das uns heute als zweites Konzert bekannte Konzert in B-Dur Op. 19 vorgestellt wurde. Angekündigt wurde "ein neues Konzert für das Pianoforte, gespielt und geschrieben von Maestro, Herr Ludwig van Beethoven". Die Anfänge der Komposition reichen bis in das Jahr 1790 zurück. Damals lebte Beethoven noch in Bonn und begann als Solist viele Konzerte zu geben: in Bonn, Wien und auf Konzertreisen. Das Konzert hat bis zu seiner ersten gedruckten Ausgabe im Jahr 1801 vier verschiedene Versionen durchlebt. Die ersten Quellen belegen wie erwähnt den Beginn der Komposition als neunzehnjähriger im Jahr 1790 in Bonn. Weitere Versionen entstanden in den Jahren 1793 und 1794, wobei der uns heute als dritte Satz bekannte hinzugefügt wurde. Gerade an diesem Rondo im 6/8 Takt, zeigen sich auffällige Merkmale. Als erstes die metrische Verschiebung des Hauptthemas, welches die ungewöhnliche Synkope hervorruft. Die erste Note erscheint auf dem metrischen ersten Schlag und nicht wie erwartet als Auftakt. Synkopen bleiben auch den ganzen Satz über das verbindende rhythmische Element. Nur einmal, in der Coda nämlich, erscheint das erste Achtel als Auftakt, allerdings in der völlig überraschenden "falschen" Tonart G-Dur. Der Umgang mit Tonarten ist besonders im dritten Satz grundsätzlich äußerst bemerkenswert. So erscheint die Mollvariante des Themas zunächst in g-, anschließend in c- und völlig unvermittelt in dem weit entfernt liegenden b-moll. Überhaupt ist die motivische Arbeit an der Entwicklung des Themas sehr beachtlich und sicher durch seinen in dieser Zeit neu gewonnenen Lehrer Joseph Haydn beeinflusst. Ebenso der Schluss des Rondos, welcher bis heute seine humoristische Wirkung nicht eingebüßt hat. Vollkommen verloren scheint hier das Soloklavier zu kadenzieren, bevor das Orchester ganz unvermittelt im subito fortissimo dem Konzert die fünf reißerischen Schlusstakte setzt. Nicht auch zuletzt der oben genannte synkopische Charakter, welcher ebenfalls auf Haydns Einflüsse der Folklore in seiner symphonischen Musik zurückgeführt werden könnte. Die endgültige Fassung der Orchesterpartitur, so wie wir sie heute kennen, entstand auf der äußerst erfolgreichen Konzertreise nach Prag im Jahr 1798, deren Erfolg Beethoven nutzte, um das Konzert in B großzügig umzuarbeiten. Nur den endgültigen Klavierpart vervollständigte er 1801 in Wien. Der ungewöhnlich lange Zeitrahmen der Komposition über 11 Jahre macht die künstlerische Entwicklung Beethovens, vom reisenden Virtuosen hin zum sesshaften Komponisten in dieser Zeit sehr deutlich. Gleichzeitig zeigt es auch den kontinuierlichen Prozess der Distanzierung von seinen Vorbildern und seiner Ausbildung. Diesen Weg verdeutlicht eben gerade die Umarbeitung eines frühen Werkes. Das Hauptmotiv des ersten Satzes erscheint im ersten Eindruck zum einen noch sehr im Sinne Mozart und Haydns, ist aber auch gleichzeitig ganz im Sinne späterer Hauptmotivik Beethovens, welche in erster Linie zur Weiterverarbeitung existiert. Vergleichen wir es nur einmal mit dem Hauptthema der "Eroica" - hier wie dort besteht das Thema ausschließlich aus Dreiklangsbrechungen, deren motivische Entwicklung sich durch den ganzen Satz ziehen. Ebenso charakteristisch die vollkommen gegensätzliche lyrische Antwort, welche bereits im zweiten Takt unvermittelt auf das markante Hauptmotiv folgt. Genauso bezeichnend ist der Dialog zwischen Klavier und Orchester, welcher den zweiten Satz, das Adagio, beschließt und mit "con grande espressione" überschrieben ist. Das Klavier scheint das Orchester zu überzeugen und beruhigen zu können - genauso wie in dem späteren zweiten Satz des vierten Klavierkonzertes. Auf Initiative des Stuttgarter Klavierpädagogen und Herausgeber Prof. Dr. Sigmund Lebert, entstanden 1881 mehrere Bearbeitungen der Klavierkonzerte Ludwig van Beethovens "...für die Begleitung eines Streichquintett oder des Orchester, zum Gebrauche für das Studium und für den Concertsaal", für die er bekannte Komponisten gewinnen konnte, wie Franz Liszt oder Vincenz Lachner. Die Bearbeitung des zweiten Konzertes verdanken wir letzterem, welches durch sorgfältige Aufteilung der Stimmen und raffinierte Orchestrierung den Konzerten einen faszinierenden, selten zu hörenden kammermusikalischen Ton geben und die mit dieser Einspielung zum ersten Mal auf Tonträger erscheinen.
Peter Leipold

Galina Ustwolskaja ~ Konzert für Klavier, Streichorchester und Pauken
"Nicht Sie stehen unter meinem Einfluss, sondern ich unter Ihrem". Dieses populär gewordene Zitat ihres Lehrers Dmitri Schostakowitsch wird wohl immer an erster Stelle in Verbindung mit seiner Schülerin Galina Ustwolskaja gebracht werden. Ebenso auch das Verhältnis "Lehrer - Schülerin", ungeachtet dessen, dass sich Ustwolskaja bis zu ihrem Tod eben von diesem Verhältnis zu Schostakowitsch heftig zu distanzieren versuchte. Dies scheint ein offensichtliches Zeichen der Aufrichtigkeit, als auch des Strebens nach Unvoreingenommenheit und Ungebändigtheit der Komponistin zu sein. Diese Adjektive umschreiben auch sicher am besten ihr nur wenige Werke umfassendes Euvre, welches sich scheinbar keiner Stilrichtung anpassen lässt. Obwohl sie ihre Heimatstadt bis zu ihrem Tode im Jahr 2006 kaum verließ, blieb sie auch in dem St. Petersburger Musikleben sowohl unter dem Sowjetregime als auch in der postsowjetischen Zeit eine rätselhafte Erscheinung, unangetastet aller politischen oder ästhetischen Strömungen. Dabei war das Leben als Außenseiterin durchaus freiwillig gewählt. Ustwolskaja duldete keine oberflächliche Einmischung - so schreibt die Musikwissenschaftlerin Olga Gladkowa - aus dem Wunsch heraus, die eigene Individualität, ihre Fassung und ihren Willen zu bewahren. So nahm sie auch niemals einen Kompositionsauftrag an, im Gegenteil, sie verweigerte sogar teilweise die Interpretation ihrer Werke, wenn sie der Komponistin als nicht "echt" erschienen.
Gerade in ihrem "Konzert für Klavier, Streichorchester und Pauke" von 1946, beginnt die Komponistin sich auf bemerkenswerte Weise von ihren akademischen Einflüssen zu entfernen, neue Wege zu gehen und vor allem völlig eigene Ausdrucksformen zu finden. Nicht ohne Grund beginnt sie erst ab diesem Konzert eine offizielle Werkeliste anzulegen. Das erste auffällige Merkmal ist die einteilige Form - von der Komponistin als zusammenhängend und dennoch kontrastierend beschrieben.
Der Anfang, das Hauptthema des Konzertes, ist stark auf den Rhythmus konzentriert. Keine Note scheint zu viel. Das Klavier bricht aus der Stille explosionsartig heraus, mit den markanten Punktierungen im Fortissimo, welche vom ganzen Orchester unisono wiederholt und von der Pauke in zwei Schlägen zusammengefasst werden. Aus diesem Anfangsthema entwickeln sich alle weiteren Themen des Konzertes - Olga Gladkowa vergleicht hier das konzentrierte Thema mit einer Kernreaktion, nach deren Explosion unendlich kleine Atome hervorgerufen werden, gleichzeitig zerstörerisch und schöpferisch. Daneben im subito Pianissimo eine schlichte Melodie, um sich kreisend, lyrisch aber nirgendwohin führend. Auch hier ein grundlegendes Merkmal der späteren Werke Ustwolskajas. Das wilde sich ausbreitende zweite Thema, scheint in einer Art Fuge hereinzustürmen. Jedoch werden akademische Vorgänge, Schablonen, konsequent vermieden und das Fugato auf individuelle Art ständig in andere Wege geleitet. Wie ein Kaleidoskop, aus dem immer unerwartete Bilder entstehen. Neben dem betont starren und konzentrierten 4/4 Takt, steht das ruhige Nebenthema im ruhig fließenden, schwingenden 6/8 Takt. Das von der Komponistin als "zusammenhängend" beschriebene, geschieht vor allem auch durch die starken Kontraste. Bemerkenswert ist vor allem die Coda des Konzertes. Die rhythmisch auffälligen 32tel Punktierungen werden aus dem Anfangsthema herausgenommen und mit voller Wucht immer und immer wiederholt. Es entsteht ein ungehörter, gewaltiger Aufbau, der jedoch anstatt auf die Katastrophe zuzulaufen im Moment der äußersten Spannung in einen sich immer wiederholenden und zum Ende des Konzertes crescendierenden C-Dur Akkord mündet. Die immense Konzentration auf einen Rhythmus, die ständige Wiederholung desselben und die daraus entstehende ungebändigte Wucht, sprechen von der oben genannten ungeheuerlichen neuen Sprache der Komponistin. Obwohl das große crescendo der Coda in C-Dur steht, scheint es Assoziationen unterschiedlichster Art hervorzurufen. Im Gespräch unter den jungen Musikern im Ensemble möchte ich hier drei unterschiedliche Eindrücke beschreiben. Zum einen das Gefühl der großen Gnade, die reinigende Wirkung nach einem Gebet, die Vergebung. Dieser Empfindung steht die Bedrohung gegenüber. Eine Wand die auf einen zukommt, ohne Entrinnen, erbarmungslos. Die dritte Assoziation ist ähnlich der These zu Schostakowitschs fünfter Symphonie - der Jubel unter Zwang. Ein mit Sehnsucht erwartetes Kriegsende des Schreckens.
Peter Leipold

 Authentic Classical Concerts zu veröffentlichen, heisst für uns, herausragende Aufführungen und Konzerte für die Nachwelt festzuhalten und zu vermitteln. Denn Künstler, Publikum, Werk und Raum treten in einen intimen Dialog, der in Form und Ausdruck - in seiner Atmosphäre - einmalig und unwiederbringlich ist. Diese Symbiose, die Spannung der Aufführung dem Hörer in all ihren Facetten möglichst intensiv erlebbar zu machen, indem wir die Konzerte direkt in Stereo-Digital-HD aufzeichnen, sehen wir als Ziel, als Philosophie unseres Hauses. Das Ergebnis sind einzigartige Interpretationen von musikalischen und literarischen Werken, schlichtweg - audiophile Momentaufnahmen von bleibendem Wert. Blühende Kultur, dem Publikum vor Ort und nicht zuletzt auch Ihnen zur Freude, sind somit jene Werte, welche wir in unseren Editionen und Reihen dokumentieren.
Authentic Classical Concerts zu veröffentlichen, heisst für uns, herausragende Aufführungen und Konzerte für die Nachwelt festzuhalten und zu vermitteln. Denn Künstler, Publikum, Werk und Raum treten in einen intimen Dialog, der in Form und Ausdruck - in seiner Atmosphäre - einmalig und unwiederbringlich ist. Diese Symbiose, die Spannung der Aufführung dem Hörer in all ihren Facetten möglichst intensiv erlebbar zu machen, indem wir die Konzerte direkt in Stereo-Digital-HD aufzeichnen, sehen wir als Ziel, als Philosophie unseres Hauses. Das Ergebnis sind einzigartige Interpretationen von musikalischen und literarischen Werken, schlichtweg - audiophile Momentaufnahmen von bleibendem Wert. Blühende Kultur, dem Publikum vor Ort und nicht zuletzt auch Ihnen zur Freude, sind somit jene Werte, welche wir in unseren Editionen und Reihen dokumentieren.